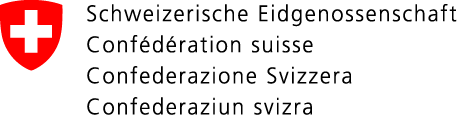Intervista, 2 ottobre 2023: Tages-Anzeiger; Charlotte Walser, Mario Stäuble
(Questo contenuto non è disponibile in italiano.)
In Lampedusa kommen sehr viele Flüchtlinge an, in der Schweiz werden die Plätze für Asylsuchende knapp. Wie weiter? Die Asylministerin antwortet und sagt, was sie von der SVP-"Grenzschutzinitiative" hält.
Frau Baume-Schneider, aus Lampedusa erreichen uns dramatische Bilder. Die Zahl der Asylgesuche nimmt auch in der Schweiz zu. Wie schwierig wird es in den kommenden Wochen?
Die Bilder wühlen auf. Sie zeigen eine sehr schwierige Situation. Gleichzeitig gibt es einige Ambivalenz. Die Menschen, die in Lampedusa ankommen, haben eine Überfahrt über das Meer überlebt – eine Überfahrt, auf der viele sterben. Auf die Schweiz wirkt sich Lampedusa aber erfahrungsgemäss nicht stark aus. Von jenen, die über Italien an der Schweizer Grenze ankommen, stellen nur drei Prozent bei uns ein Asylgesuch. Ein grosser Teil dieser Menschen kommt aus Nordafrika und hat kein Recht auf Schutz. Kommen sie in die Schweiz, müssen sie zurückkehren.
Die Zahl der Asylgesuche steigt dennoch. Wie lauten die Prognosen für den Herbst?
Wir befinden uns immer noch im mittleren Szenario. Wir rechnen also für 2023 mit 28’000 bis 30'000 Asylgesuchen.
Die Unterkünfte werden knapp. Seit Monaten zanken sich Bund und Kantone um die Betten. Im August waren Sie noch zuversichtlich, jetzt sieht es wieder schlecht aus. Wer ist schuld?
Es bringt nichts, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Bund, Kantone und Gemeinden arbeiten eng zusammen, die Bewältigung dieser Herausforderung ist eine gemeinsame Aufgabe. Ich verstehe, dass auch die Kantone unter Druck stehen, wünsche mir aber, dass es unter ihnen mehr Solidarität gibt. Einige stellen dem Bund nun Plätze zur Verfügung, andere nicht.
Bisher haben Sie 1000 zusätzliche Plätze organisieren können. Das reicht nicht, oder?
Wir werden sehen. Wir haben auch noch die Plätze, die uns die Armee weiterhin nutzen lässt. Aber ja, wir brauchen weitere, damit wir etwas Spielraum haben. Die Container mit 3000 Plätzen wären für den Bundesrat die beste Lösung gewesen. Das Parlament hat anders entschieden. Jetzt haben wir sehr viel Aufwand für eine komplizierte Lösung mit verstreuten Unterkünften. Aber ich bin immer noch zuversichtlich.
Es entsteht der Eindruck, dass sich Bund und Kantone gegenseitig die Verantwortung zuschieben.
Wenn man sieht, wie die Situation etwa in Belgien ist, wo der Migrationsdruck auf der Strasse sichtbar ist …
… Sie meinen, dass die Menschen auf der Strasse leben …
… bei uns ist es nicht so. Jede und jeder hat ein Dach über dem Kopf. Aber wo Sie recht haben: Wir müssen den Asylnotfallplan überarbeiten. Dieser sieht aktuell 9000 Plätze vor. Es bräuchte deutlich mehr für ausserordentliche Situationen.
Kantone und Armee müssen also künftig mehr Unterkünfte definieren, die Sie im Notfall dem Bund überlassen können?
So einfach ist es nicht. Die Armee braucht viele Infrastrukturen, die momentan als Bundesasylzentren genutzt werden, mittelfristig selber. Wir werden jetzt mit Kantonen und Gemeinden Vorschläge erarbeiten, wie die Kapazitäten erhöht werden können.
Sie waren eben am Treffen der Schengen-Innenminister. Diese ringen um eine Asylreform. Wie schätzen Sie die Chancen ein?
Am Morgen hatten wir alle das Gefühl, dass es mit der Situation in Lampedusa ein Momentum gibt, um eine Einigung zu erzielen. Alle wollten. Aber im Verlauf des Tages hat Italien dann Einwände vorgebracht. Die Länder haben unterschiedliche Erwartungen, etwa zum Umgang mit Familien in den geplanten Zentren an den Schengen-Aussengrenzen. Ich hoffe und glaube aber, dass es bald eine Einigung gibt. Dann kann die Reform dem EU-Parlament vorgelegt werden.
Geplant ist mehr Solidarität zwischen den Staaten. Wird die Schweiz zu jenen Ländern gehören, die Flüchtlinge aus den Grenzstaaten übernehmen – oder wird sie zahlen?
Die Schweiz ist nicht gebunden. Es wird eine politische Diskussion sein, ob und wie wir uns beteiligen.
Was ist Ihre Haltung?
Der Bundesrat wird darüber entscheiden. Ich gehe aber davon aus, dass wir solidarisch sein werden. Wir dürfen nicht vergessen: Wir sind Schengen-Partner und beteiligen uns schon heute finanziell, zum Beispiel an Frontex.
Kritik und Missverständnisse gab es zur Praxisänderung für Afghaninnen. Diese erhalten neu Asyl statt einer vorläufigen Aufnahme. Warum sind Sie nicht hingestanden und haben den Entscheid erklärt?
Das Staatssekretariat für Migration passt die Praxis für viele Herkunftsländer laufend an. Im Fall der Afghaninnen hat es dabei die Richtlinie der EU-Asylagentur und die Praxis anderer Länder berücksichtigt. Die Situation der Frauen hat sich seit der Machtergreifung der Taliban stark verschlechtert. Sie werden wegen ihres Geschlechts massiv unterdrückt. Wir hielten es nicht für angezeigt, die Praxisänderung an die grosse Glocke zu hängen. Aber wir haben auch nichts versteckt: Im Mai hat der Bundesrat eine entsprechende Frage des Parlaments beantwortet.
Die Politik beschäftigt auch die Frage, ob abgewiesene Asylsuchende zurückkehren. Dazu haben Sie im Parlament interessante Zahlen genannt: In der Schweiz liegt die Rückkehrquote bei 57 Prozent, in der EU lag sie jüngst nie über 32 Prozent. Was macht die Schweiz besser als andere Länder?
Das Staatssekretariat für Migration leistet ausgezeichnete Arbeit bei den Partnerschaften mit den Herkunftsländern. Den Verantwortlichen gelingt es, ein Vertrauensverhältnis herzustellen, was sehr wichtig ist. Das wird oft zu wenig wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit Algerien zum Beispiel ist sehr gut. Insgesamt haben wir über sechzig Abkommen zur Rückkehr und acht umfassende Migrationspartnerschaften, die auch im Interesse der Herkunftsländer sind. Dank der konsequenten Rückführung abgewiesener Asylsuchender ist unsere Asylpolitik glaubwürdig und akzeptiert.
Und wo muss die Schweiz besser werden?
Als das Asylgesetz beschlossen wurde, rechnete man nicht mit so vielen unbegleiteten Minderjährigen. Hier müssen wir uns Gedanken machen – zur Betreuung, zur Ausbildung, zur Integration. Wenn die Integration nicht gelingt, riskieren wir, dass uns diese jungen Menschen später Schwierigkeiten bereiten.
Italien nimmt keine Asylsuchenden mehr zurück, die zuerst dort registriert wurden. Haben Sie am Innenministertreffen mit Ihrem italienischen Amtskollegen darüber gesprochen?
Ich habe das Thema bei meinem Besuch in Rom sehr direkt angesprochen. Minister Matteo Piantedosi sagte, Italien sei dabei, Asylstrukturen auszubauen. Danach werde man die Dublin-Regeln wieder einhalten. In der gegenwärtigen Situation – mit dem Druck in Lampedusa und der fehlenden Solidarität anderer Länder – steht für Italien wohl anderes im Vordergrund als die Rückübernahme von Personen aus anderen Ländern. Aber ja, auch Italien muss die Spielregeln einhalten. Man kann nicht Teil von Schengen sein und dann nur à la carte jene Regeln anwenden, die einem passen.
Wie solidarisch ist die Schweiz mit Italien?
Die Schweiz unterstützt Italien, Zypern und Griechenland finanziell. Für Italien sind 20 Millionen Franken vorgesehen. Wir werden bald ein Abkommen dazu unterzeichnen.
Manche sagen: Die Schweiz sollte diesen Betrag zurückbehalten, bis Italien die Regeln wieder einhält.
Wir sind nicht in der Épicerie: Gibst du mir das, gebe ich dir dies. Es geht um etwas anderes: Um zu verhindern, dass Menschen zu uns kommen, muss man vor Ort helfen. Italien ist nicht überlastet mit Menschen, die dortbleiben – Italien ist unter Druck, weil eine Migrationsroute durch das Land führt. Wenn wir helfen, Strukturen aufzubauen, ist das auch in unserem Interesse.
SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi stellt eine Volksinitiative in Aussicht unter dem Arbeitstitel "Grenzschutzinitiative". Dazu sollen systematische Grenzkontrollen gehören.
Nun – die Schweiz gehört zu Schengen. Das Volk hat dies auch wiederholt bestätigt, zuletzt mit dem klaren Ja zu Frontex. Systematische Kontrollen an den Binnengrenzen dürfen nur eingeführt werden, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit vorliegt. In einer solchen Situation sind wir nicht. Hinzu kommt das Praktische: der Grenzverkehr mit den vielen Grenzgängern.
Es käme zum Verkehrschaos?
Ich habe schon den Vorschlag gehört, dass man zwei Kolonnen machen könnte: eine für die Grenzgänger und eine für Migranten. Ich habe leise Zweifel, dass das funktionieren würde. Momentan gibt es viel deklamatorische Politik: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat vieles angekündigt, aber die Menschen kommen trotzdem. Manche Ideen tönen gut, sind aber nicht realisierbar. Die Idee, man könne die Grenzen einfach zumachen, gehört für mich dazu.
Zweitens will Herr Aeschi an der Grenzen Transitzonen einrichten, in denen Asylsuchende bleiben müssen.
Auch dazu hat sich der Bundesrat schon geäussert. Ich finde den Vorschlag seltsam. Die Last würde einseitig auf die Grenzkantone geschoben. Es wäre auch rechtlich problematisch, Personen ohne Haftgrund in Transitzonen einzusperren.
Die dritte Forderung: Herr Aeschi will die vorläufige Aufnahme abschaffen.
Es stimmt, dass ein Grossteil der vorläufig aufgenommenen Personen länger in der Schweiz bleibt. Aber das lässt sich nicht dadurch ändern, dass man einfach die vorläufige Aufnahme abschafft. Wir können schon beschliessen, jemand in sein Herkunftsland zurückzuschicken. Aber wenn ein Land – wie zum Beispiel Eritrea – seine Bürgerinnen und Bürger nicht zurücknimmt, nützt das nichts. Wir können die Menschen auch nicht einfach irgendwo deponieren. Es sind falsche Versprechen, die hinter diesen Forderungen stecken. Damit wird die Bevölkerung getäuscht.
Schlagzeilen machte der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Parlamentarierinnen fordern nun, dass der Bund aktiv wird: Er soll Schutzkonzepte vorschreiben und deren Einhaltung kontrollieren. Was sagen Sie als Justizministerin dazu?
Ich bin schockiert über die Befunde dieser Studie. Die katholische Kirche hat systematisch die Täter geschützt statt die Opfer. Ich hoffe, dass die Opfer weiterhin den Mut finden, zu reden. Was wir tun können? Die Zuständigkeit liegt primär bei den Kantonen. Sie erteilen zum Beispiel die Bewilligung für ein Internat und stehen in Kontakt mit den Bischöfen. Ich kann mir aber vorstellen, Missbrauch in der Kirche in die Roadmap zu häuslicher und sexueller Gewalt aufzunehmen. Dass der Bund bei Schutzkonzepten eine koordinierende Rolle spielt, wäre ebenfalls denkbar, aber ich will da nicht vorgreifen. Was wichtig ist: Das Strafrecht steht über dem Kirchenrecht, und die Justiz muss jetzt ihre Arbeit machen.
Sie sind bald ein Jahr im Amt. Im Parlament zeigten Sie sich kürzlich erleichtert über eine Frage, die mit Bildung zu tun hatte. Als ehemalige Bildungsdirektorin seien Sie mit dem Thema bestens vertraut, meinten Sie. Das klang, als ob Sie mit Justiz und Asyl noch nicht vertraut wären.
Doch, natürlich. Aber es freute mich, auf meine berufliche Vergangenheit verweisen zu können. In der Deutschschweiz kennt man mich nicht so gut. Manche glauben, ich sei Schafzüchterin gewesen.
In Umfrage-Rankings haben sie bisher schlecht abgeschnitten. Man hält Sie für die Bundesrätin mit dem geringsten Einfluss.
Es sind – mit Ausnahme von Alain Berset – die Lateiner, die für weniger einflussreich gehalten werden. Natürlich macht es mir keine Freude, wenn ich das lese. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht schlafe im Bundesrat. Ich bringe mich ein.
Bis jetzt kandidieren für Alain Bersets Nachfolge drei Männer: Aebischer, Jans, Jositsch. Ein Argument bei einem Teil der SP geht so: Der Bundesrat war über 100 Jahre lang nur mit Männern besetzt, jetzt darf das Pendel ruhig in die andere Richtung ausschlagen. Sprich: Auch zwei weibliche SP-Bundesratsmitglieder sind erwünscht. Wie sehen Sie das?
Ich fände es gut, wenn eine Frau kandidieren würde. Dann entscheidet die Fraktion. Bei mir hiess es, eine Romande habe keine Chance. Et voilà.
Info complementari
Comunicati
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Discorsi
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Interviste
-
"Chiasso ist nicht Lampedusa" die Justizministerin kontert KritikArticolo, 26 novembre 2023: NZZ am Sonntag
-
Auf der Insel der HoffnungArticolo, 24 novembre 2023: Schweizer Illustrierte
-
La MatinaleIntervista, 23 novembre 2023: RTS, La Matinale
-
"Il faut parler plus de migration et d’asile"Intervista, 1° novembre 2023: Le Temps
-
"Wir können die Menschen nicht einfach irgendwo deponieren"Intervista, 2 ottobre 2023: Tages-Anzeiger
Ultima modifica 02.10.2023